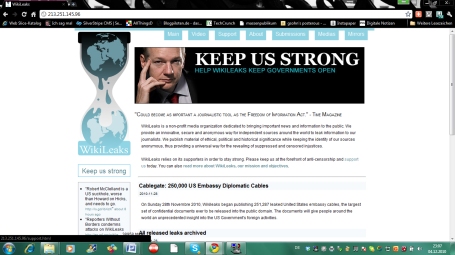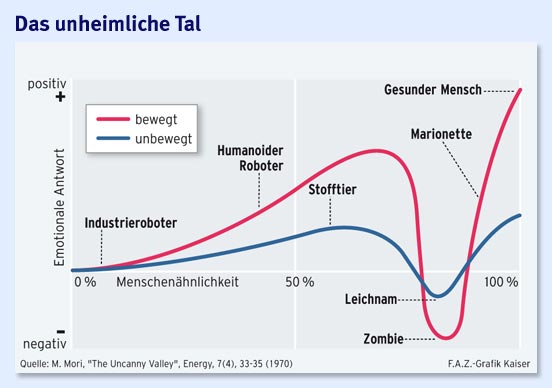aus: FAZ.NET
Die Soziologie des Lügens
Immer treu und redlich?
Wer Geheimnisse verrät, gilt als Schuft. Oder als Held, je nachdem. Wie viel Aufrichtigkeit verträgt ein Sozialwesen? Der Fall „Wikileaks“ ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn diese Regeln verletzt werden.
Von Jürgen Kaube
5. Dezember 2010
Jede soziale Beziehung beruht darauf, dass die Beteiligten zwar etwas und vielleicht sogar viel, aber längst nicht alles voneinander wissen. Die Diskretion, die man wahrt, die Zudringlichkeit, die man vermeidet, sind Elemente des zivilen Umganges miteinander. Das gilt für Ehepaare so gut wie für Chefs und Angestellte oder eben auch für Staaten.
Der Fall „Wikileaks“ ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn diese Regeln verletzt werden. Die am häufigsten fallenden Begriffe sind in diesem Zusammenhang: Betrug, Transparenz, Verrat, Öffentlichkeit, Aufklärung, Verlogenheit, Geheimnis. Mal sind dabei die Lügen der Politik und der Diplomatie gemeint, mal wird „Wikileaks“ die Zerstörung von politischem Vertrauen vorgeworfen. Darauf entgegnen die Verteidiger der Publikation geheimer Dokumente, mit dem Vertrauen sei es, wenn man die Texte der Diplomaten über andere Politiker lese, offenbar sowieso nicht weit her. Außerdem gehöre Politik qua definitionem zur „res publica“, also zu den öffentlichen Dingen. Dem wiederum steht die Feststellung entgegen, dass das Briefgeheimnis auch und vielleicht sogar in besonderer Weise für Amtsträger zu gelten hat.
Nicht lügen ist theoretisch leicht
Vor mehr als hundert Jahren wurde eine Tradition der Soziologie begründet, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Ihre Gründungsdokumente sind zwei Texte von Georg Simmel: Seine 1899 verfasste „Psychologie und Soziologie der Lüge“ sowie das fünfte Kapitel seiner 1908 erschienenen „Soziologie“ unter dem Titel „Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft“. Beide beschäftigen sich mit der Frage, wie viel Aufrichtigkeit das soziale Leben braucht und wie viel es davon aushält.
Es gibt, schreibt Simmel, eine besondere Beziehung der Wahrhaftigkeit zum Ich-Gefühl. Das Ideal, nicht zu lügen, ist, psychologisch betrachtet, viel leichter zu erfüllen als alle anderen Tugenden. Es liegt nur am Individuum, es nicht zu tun. Der Lügner dagegen verletzt nicht nur Pflichten gegen andere, er tritt buchstäblich auch in Widerspruch zu sich selbst.
Wer einmal lügt…
Zum Thema
Denn der Lügner muss, Simmel zufolge, stets zwei Vorstellungsreihen in seinem Bewusstsein wachhalten – seine wirkliche Meinung und die nach außen dargestellte. Das spaltet seine Persönlichkeit, macht aber auch ein besonderes Geschick erforderlich. Die Lüge muss im Einklang mit Tatsachen stehen, in deren Bild sie jedoch etwas einfügt, was nicht dahin gehört. Leicht zieht eine Lüge dann weitere nach sich, die zur Unterstützung der ersten („Wir hatten noch eine späte Sitzung, Schatz“) eingesetzt werden. Neurowissenschaftliche Studien haben ergeben, dass gelogene Antworten stets um Bruchteile einer Sekunde später erfolgen als wahre.
Der Lügner galt Simmel als Inbegriff dessen, der nicht nur gegen das Gute agiert, sondern auch gegen das Wahre. Insofern schwimme er gegen den Strom. Das freilich gilt nur für Lügner, die in der Sache lügen. Ein wenig anders verhält es sich mit Leuten, die Freundlichkeit vorgeben und in Wahrheit unfreundlich sind, die also über Tatsachen hinwegtäuschen, die sie selbst betreffen. Sie lügen nicht, sie spielen eine Rolle.
Rollenspiel oder Lüge?
Das Rollenspiel besitzt nun aber die Eigenschaft, dass dem Spieler im Unterschied zum Lügner ein Teil seines Aufwandes an Verstellung von der sozialen Situation abgenommen wird. Es war der amerikanische Botschafter ja schließlich nicht von der Kanzlerin gefragt worden, ob er sie für kreativ halte oder was er denn so über ihren Außenminister denke. Er musste gar nicht lügen. Zeremoniell, Höflichkeit, Rhetorik erlauben es dem, der sich verstellt, mit dem gesellschaftlichen Strom zu schwimmen. Ja, es ist mitunter nicht einmal Verstellung im Spiel: Von Diplomaten wird traditionell erwartet, dass sie nach außen verbindlich sind. Der Aphorismus, wonach Diplomatie die Kunst sei, zweimal nachzudenken, bevor man gar nichts sage, beschreibt dieses Zuhausesein in Formalitäten.
Der Begriff der sozialen Rolle, den der amerikanische Ethnologe Ralph Linton 1936 einführte, meint genau dies: allgemeine Erwartungen, die das Individuum davon entlasten, all seine Handlungen auf die eigene Kappe zu nehmen. Die Rolle befreit vom Vorwurf der Lüge. Das Individuum verstellt sich nicht, sondern es handelt zum Beispiel als Kellner, Vater, Kläger oder Wähler auf jeweils unterschiedliche Weise, die es selbst nicht begründen muss. Diplomatie ist für die soziologische Rollentheorie schon darum ein paradigmatischer Fall, weil in diesem Wort zwei Bedeutungen zusammenkommen. Die eine meint politische Gesandtschaften, die andere Techniken der Imagepflege, also des Versuchs, vor anderen ein Selbstbild aufrechtzuerhalten. Diplomatisch wird insofern auch außerhalb der Diplomatie agiert.
Diplomatische Anfänge
Die Diplomatie im engeren Sinne ist Kind eines Zeitalters, in dem zum ersten Mal offen und positiv über Täuschung als Mittel der Politik gesprochen wurde. Den Anfang machte 1455 das Herzogtum Mailand, als es seine Vertreter bei der Republik Genua als ständige Gesandte bezeichnete. Es war, wie Pietro Gerbore in seiner Geschichte der Diplomatie formulierte, die Zeit der Ränkespiele des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza, genannt „il Moro“, der Dunkle, und die des berüchtigtsten aller politischen Theoretiker, Niccolò Machiavelli, der auf Jahrhunderte hinaus verhasst war, eben weil er die Verstellung als ganz normales Mittel der Politik bezeichnet hatte.
Dass Gesandte ein freundliches Gesicht gegenüber Politikern machen, die sie in ihren Berichten anschließend in scharfe Beleuchtung setzen, ist seitdem erwartbar. Wer es Lüge nennt, sollte sich fragen, wie viel er selber seiner Umgebung von sich preisgibt. Dass die Grundunterscheidung des diplomatischen Handelns die zwischen Vorderbühne und Hinterbühne ist, sollte eigentlich niemanden überraschen.
Zwei verschiedene Rollenerwartungen
Der 1982 verstorbene kanadische Forscher Erving Goffman, eine Jahrhundertfigur der empirischen Sozialforschung, hat diese Unterscheidung als eine allgegenwärtige gesellschaftliche Struktur beschrieben. Für Goffman ist das soziale Leben vor allem vom Versuch aller Beteiligten bestimmt, ihr Gesicht zu wahren. Um weder das persönliche Gesicht noch das der jeweiligen Rolle zu verlieren, müssen bestimmte Handlungen unsichtbar bleiben. So ist der Kellner zwar derjenige, der den Gast bedient. Er ist gleichzeitig aber auch Kollege der anderen Kellner. Beides passt nicht immer zusammen, also wird die Interaktion mit den Kollegen auf die Hinterbühne des Restaurants verlagert, auf der dann der Klatsch über die Gäste gemeinschaftsbildend wirkt. Man sieht sofort die Analogie zum Diplomaten, der ebenfalls zwei komplementäre Rollenerwartungen kennt: die seines Dienstherrn und die der Politiker, mit denen er umgeht.
Der norwegische Soziologe Vilhelm Aubert hat in seinen „Elements of Sociology“ von 1967 drei Strategien identifiziert, die in solchen Fällen zum Einsatz kommen. Zum einen ist das die räumliche Trennung des Publikums von den Akteuren in Form von Restaurantküchen, Lehrerzimmern, Büros ohne Publikumsverkehr. Oder es bildet sich eine zeitliche Hinterbühne, wie beim Gespräch der Eltern, wenn die Kinder zu Bett gebracht wurden. Auch Frau Merkels SMS-Gebrauch gehört dazu, und man würde sich vermutlich wundern, wenn „Wikileaks“ diese Dokumente publizieren würde.
„Geheimsprache“
Eine zweite Strategie besteht in der Verwendung von Sprachen, die das eine Publikum versteht, das andere aber nicht, etwa wenn Ärzte untereinander Latein vor Patienten reden. Oder wenn Eltern sich in Anwesenheit der Kinder nur mittels Anspielungen verständigen. Und schließlich ist auch das Spezialistentum ein Weg, Rollenkonflikte in einer Person zu vermeiden: Wenn die Amerikaner beispielsweise für das freundliche Auftreten gegenüber der Kanzlerin den Botschafter beschäftigt hätten und für die abfälligen Berichte einen eigenen Geheimdienstmann, hätte der US-Botschafter Philip Murphy jetzt kein persönliches Imageproblem.
Jede soziale Situation hat insofern im buchstäblichen oder übertragenen Sinn eine Hinterbühne. Sogar dort, wo es erklärtermaßen um Öffentlichkeit geht: Wenn Sitzungen des Parlaments im Fernsehen übertragen werden, führt das nicht zu mehr Transparenz, sondern zur Klage über den dann angetretenen Rückzug in die „Hinterzimmer“. Oder die Beschwerde lautet, die Politiker stritten sich nur vor den Kameras, wenn diese hingegen ausgeschaltet seien, herrsche Kumpanei. Man sieht: Ob die Kameras an sind oder aus, ändert gar nichts an der Existenz von Hinterbühnen und daran, dass vorn vor Publikum mindestens eine Seite Theater spielt.
Hinterbühnen in den Medien
Joshua Meyrowitz, ein Schüler Erving Goffmans, der an der Universität von New Hampshire lehrt, hat daraus eine Theorie des Journalismus abgeleitet. Insbesondere das Fernsehen, so seine These in „No Sense of place“ (deutsch: „Die Fernseh-Gesellschaft“, 1987), aber auch andere elektronische Medien zerstören Hinterbühnen. So seien die Frauen in den späten sechziger Jahren erst durch die Medien mit der Berufswelt ihrer Männer bekanntgemacht worden, die Kinder mit dem, was Eltern sonst von ihnen fernhalten wollten, das Volk schließlich mit dem Erscheinungsbild seiner Politiker. So kam es, meint Meyrowitz, 1968 zum Protest einer vom Fernsehen sozialisierten Generation.
Das leuchtet auch im vorliegenden Fall ein: Allein die Tatsache, dass nun überall versucht wird, bei „Wikileaks“ nachzuschauen, wer was über wen gesagt hat, schleift die Hinterbühne der Diplomatie. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit durch das Internet ist hier deutlich greifbar. Wenn aber die Diplomatie keine Lüge ist, sondern nur der Inbegriff des Rollenhandelns, ohne das niemand auskommt – kann dann die Offenlegung des diplomatischen Alltags Wahrheit sein? Missstände aufzudecken, die sich auf Hinterbühnen verbergen, ist eine Aufgabe von Journalisten. Doch ist die Existenz von Hinterbühnen selber ein Missstand?
Der Reiz der Mitteilung liegt deshalb weniger auf der Sachebene als in der Destruktion eines Images, im gezielten Kollabierenlassen einer Vorderbühnendarstellung. Aber das betrifft nur den Botschafter persönlich. Diplomatie an sich wird niemals im Sinne von „Wikileaks“ aufrichtig sein können. Es bleibt der Eindruck, dass das Interesse am Botschafter, der vorne kratzfüßig ist und hinten ein Schandmaul, weniger der Information und der Aufklärung dient als vielmehr der Unterhaltung. So gesehen, tut „Wikileaks“ in diesem Fall nur, als decke es eine Machenschaft auf. Und so gesehen, ist das Internetforum jetzt selbst zu einem Beispiel dessen geworden, was es anprangert.
_______________________________________________________________________________________________________
Nota.
Da dieser Autor fein sachlich bleibt, darf ich mir die Bemrkung erlauben: Welchem Zweck diese Veröffentlichungsrunde von Wikileaks gedient hat, ist auch mir nicht ersichtlich. Eine Menge Peinlichkeiten, ja ja, aber wer hat was davon? Irgendeine politische Sensation ist bislang nicht ruchbar geworden. Und selbst wenn – ob durch die Abschaffung der Geheimdiplomatie der Frieden in der Welt sicherer oder die Verteilung der Reichtümer gerechter würde, ist durchaus fraglich.